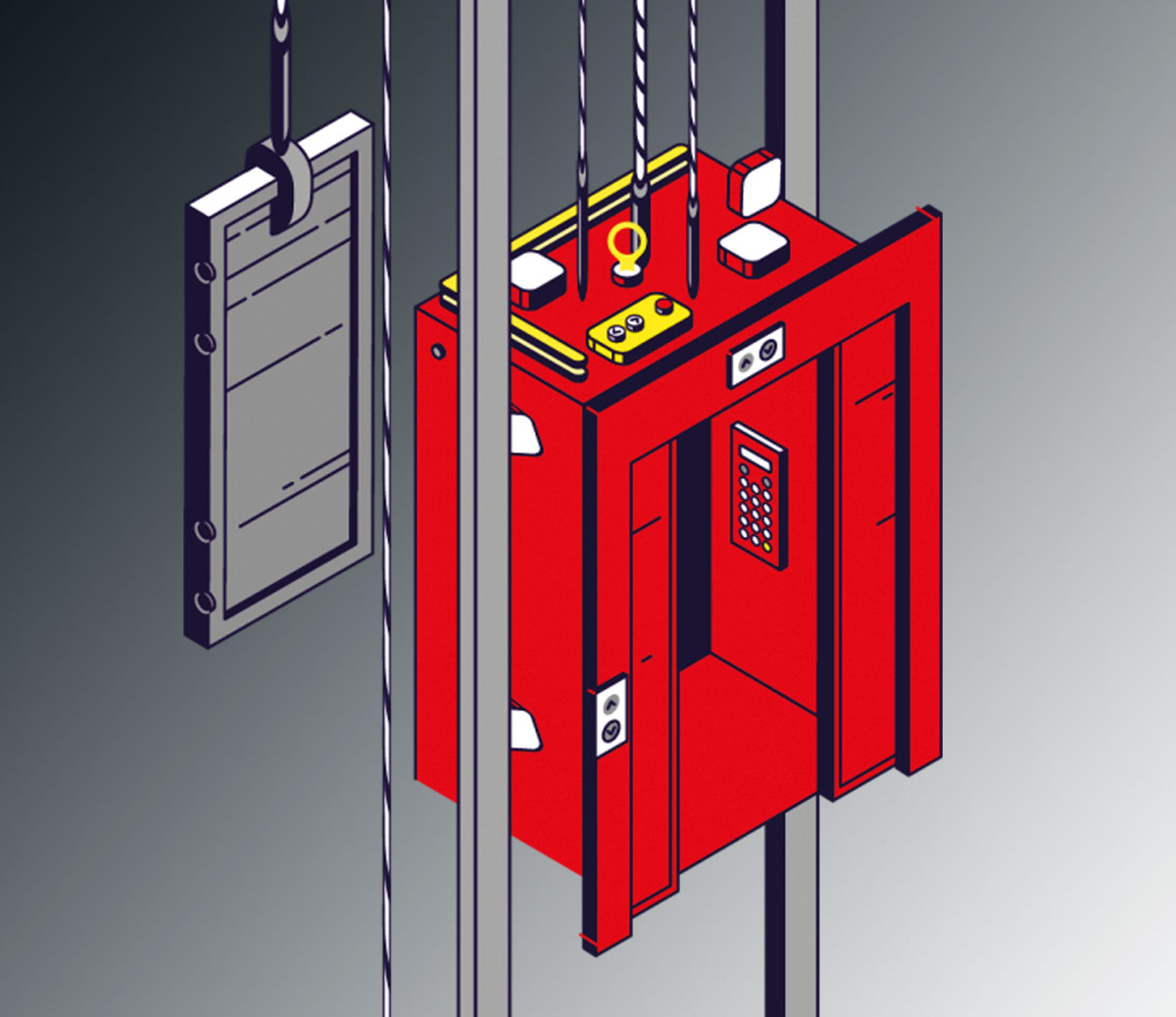MAN@FIRE
BIS AN DIE BELASTUNGSGRENZE AN DER WALDBRANDFRONT
Er sieht schwarz – und das buchstäblich. Rauch und verbrannte Vegetation rings um den Vorarlberger Markus Stengele, Feuerwehrmann aus Liechtenstein. Mitten im brennenden Nationalpark an der deutsch-tschechischen Grenze ist er einer unter Hunderten Helfern, die nicht nur gegen offensichtliche Flammen kämpfen, auch unsichtbare Gefahren stellen sich ihnen in den Weg. Was in einer ausweglos erscheinenden Situation motiviert, ist der Zusammenhalt.

T
schechien, 25. Juni 2022: Ein Feuer bricht in der an Deutschland grenzenden Böhmischen Schweiz aus. Tags darauf greifen die Flammen auf den 9.500 Hektar großen Nationalpark Sächsische Schweiz über und setzen dabei rund 150 Hektar in Brand. Auf tschechischer Seite sind Häuser abgebrannt, Dörfer müssen evakuiert werden, Deutschland löst den Katastrophenalarm aus und der Nationalpark wird für Touristen gesperrt. Einer, der solche Szenarien nicht nur kennt, sondern bereits
Tschechien, 25. Juni 2022: Ein Feuer bricht in der an Deutschland grenzenden Böhmischen Schweiz aus. Tags darauf greifen die Flammen auf den 9.500 Hektar großen Nationalpark Sächsische Schweiz über und setzen dabei rund 150 Hektar in Brand. Auf tschechischer Seite sind Häuser abgebrannt, Dörfer müssen evakuiert werden, Deutschland löst den Katastrophenalarm aus und der Nationalpark wird für Touristen gesperrt. Einer, der solche Szenarien nicht nur kennt, sondern bereits zum wiederholten Mal zu Hilfe eilt, wenn überörtlich Not am Mann oder, wie in diesem Fall, Not am Wald ist, ist der gebürtige Vorarlberger Markus Stengele, ein Feuerwehrmann aus Liechtenstein mit Wohnsitz in Rankweil, der sich seit sieben Jahren in der gemeinnützigen Hilfsorganisation @fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V. engagiert. Noch am selben Tag, an dem das Feuer ausgebrochen ist, sucht die sächsische Behörde bei der Organisation um Hilfe an, und Stengele erhält den Einsatzbefehl: Am nächsten Tag geht es in das sieben Autostunden entfernte Bad Schandau, wo die Einsatzleitung eingerichtet wurde.
zum wiederholten Mal zu Hilfe eilt, wenn überörtlich Not am Mann oder, wie in diesem Fall, Not am Wald ist, ist der gebürtige Vorarlberger Markus Stengele, ein Feuerwehrmann aus Liechtenstein mit Wohnsitz in Rankweil, der sich seit sieben Jahren in der gemeinnützigen Hilfsorganisation @fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V. engagiert. Noch am selben Tag, an dem das Feuer ausgebrochen ist, sucht die sächsische Behörde bei der Organisation um Hilfe an, und Stengele erhält den Einsatzbefehl: Am nächsten Tag geht es in das sieben Autostunden entfernte Bad Schandau, wo die Einsatzleitung eingerichtet wurde.
Herausfordernde Verhältnisse. Was dem unaufhaltsam wütenden Feuer in die Karten spielt: Im Nationalpark wird der Natur freier Lauf gelassen. Keine Waldbewirtschaftung heißt in diesem Fall: Totes Holz, ausgedörrte Böden und Nadeln, die wie Zunder brennen, füttern die hungrigen Flammen. Felsiges, steiles Terrain sowie kaum vorhandene Forstwege und Löschteiche in dem Mittelgebirge machen den ohnehin schon anstrengenden Einsatz für die Helfer noch kräftezehrender. Aus der Luft unterstützen Löschhubschrauber den Einsatz. Das Schwierige hierbei ist allerdings, dass der Mischwald einen Großteil des Löschwassers auf dem Weg nach unten zu den Glutnestern abfängt, ein vollständiges Ablöschen kann deshalb nicht gelingen. Das Löschen über den Luftweg stellt daher nur eine Unterstützungsmaßnahme dar. Gelöscht wird ein Waldbrand am Boden und hier kommen die Waldbrandspezialisten (WFF) von @fire, begleitet von Stengele, zum Einsatz. Gemeinsam mit lokalen Feuerwehreinheiten arbeiten die Waldbrandexperten die von der Einsatzleitung priorisierten Löschaufträge ab. Dabei muss Stengele als Gruppenkommandant einer zehnköpfigen Mannschaft stets ein wachsames Auge auf den Arbeitsbereich haben, denn nicht nur das Feuer bedroht den Bodentrupp: Funktioniert die Kommunikation zwischen Boden- und Lufteinheit nicht, können die planmäßigen Wasserabwürfe aus der Luft schnell zu einer weiteren Bedrohung werden. Die Einheit kämpft auf einer fußballfeldgroßen Fläche gegen die Flammen, dabei steht ihnen aber nicht immer ein 2.000-Liter-Tank mit Wasser und Pumpe zur Verfügung. Dieses Wasserdepot wurde von einem Hubschrauber ins steile Gelände transportiert und laufend neu befüllt. Das sind vergleichsweise geringe Wassermassen, wenn es darum geht, einen extrem trockenen Wald zu löschen. Aber die Einsatzkräfte wissen sich zu helfen: Ausgestattet mit Waldbrandhaken, Feuerpatschen, speziellem Waldbrandwerkzeug – dem Gorgui und Pulsaki – und 20-Liter-Wasserrucksäcken geht das Team händisch ans Werk und versucht so, möglichst wassersparend gegen die lodernden Flammen vorzugehen.
Schweißtreibendes Unterfangen. Es ist heiß, der Rauch brennt in den Augen, und das bis zu 20 Kilo schwere Gepäck am Rücken der Einsatzkräfte zehrt bis zum Ende des Tages an den letzten Kraftreserven. Anfangs steht das Team fast täglich zwölf bis 14 Stunden im Einsatz, aber sie helfen gerne und das merkt man Stengele im Gespräch an. „Hin und wieder war es wirklich so heiß, dass man es keine Minute an einem Ort ausgehalten hat, das schweißt das Team wortwörtlich zusammen“, erinnert sich der Feuerwehrmann. Vor allem der Sandstein, der diese Landschaft prägt, erschwert das Löschen vor Ort, da er besonders gut die Hitze des Feuers speichert. Das geht sogar so weit, dass bereits gelöschtes Feuer erneut angefacht wird. Es ist ein Einsatz, der einige Tücken für die Löschmannschaft bereithält, denn sie müssen nicht nur auf große Feuerwehrschläuche verzichten, auch herkömmliche Atemschutzgeräte sind für den stundenlangen Einsatz nicht nur ungeeignet, sondern auch viel zu schwer. Eine adaptierte Einsatzkleidung für den Waldbrandeinsatz muss her: Mit erleichterter Schutzkleidung, Schutzhelm sowie Gesichtsschutzmasken mit integrierten FFP2-Masken und Schutzbrillen sind die Kräfte auf das, was vor ihnen liegt, bestens vorbereitet. Hauptaufgabe der Mannschaft rund um den Vorarlberger ist das Beseitigen der Glutnester. In stundenlanger Schwerstarbeit kämpfen sich die Helfer von Abschnitt zu Abschnitt. Händisch werden dabei Schneisen in den Boden geschlagen, dabei wird so lange gegraben, bis nur noch Erde und Steine zu sehen sind. „Die Schneise muss dabei mindestens doppelt so hoch sein, wie das Hauptfeuer“, erklärt Stengele das Vorgehen. Wenn es die Wetterlage zulässt, setzt man auf kontrolliert gelegte Feuer. Eine Methode, die erst seit Kurzem in Deutschland erlaubt ist und die nur dann zum Einsatz kommen kann, wenn es völlig windstill ist. Dem Hauptfeuer wird so brennbares Material entzogen, und die Flammen können sich zumindest in diesen Abschnitten nicht weiter ausbreiten. Es ist eine erfolgversprechende Maßnahme, die bereits seit Jahren in Gebieten wie Portugal zum Einsatz kommt, in denen solche Brandereignisse in den heißen Monaten beinahe auf der Tagesordnung stehen.
Unsichtbare Gefahren. Gerade in den Anfangstagen war der Kampf gegen die Flammen ernüchternd, denn bei Nacht verwandelte sich das unwegsame Gelände in unüberwindbares Gebiet. Die Kräfte müssen abrücken, zu gefährlich ist der Löscheinsatz, als die Sonne hinter den brennenden Wipfeln verschwunden ist. Die ersten Löscherfolge bleiben aus, die Flammen haben sich in der Dunkelheit wieder in das trockene Wurzelwerk gefressen. Zu zweit oder zu dritt patrouillieren sie in der Nacht rund um das Camp, das nur ungefähr 500 Meter vom brennenden Wald entfernt liegt. Sie beobachten den Forst aus der Ferne. Ist Gefahr im Verzug, greifen sie ein, andernfalls wird die Waldbrandbekämpfung erst am nächsten Morgen wieder aufgenommen. Mit dem Aufgang der Sonne geht auch die Suche nach den Glutnestern – die sich bis zu 40 Zentimeter tief in die dicke Rohhumusschicht direkt unter die Einsatzschuhe der Feuerwehrkräfte hineingefressen haben – wieder los. Sie stellen mit eine der größten Gefahren im Einsatz dar. Jeder Schritt will wohlüberlegt sein, denn das Risiko einer schwerwiegenden Verbrennung hätte zur Folge, dass der Einsatz ein jähes und vor allem schmerzvolles Ende finden könnte. Das unterirdische Feuer verschafft sich außerdem Zugang zu den Wurzeln der Bäume; so entsteht eine weitere vorerst unsichtbare Gefahr für die Feuerwehrleute: Die sogenannten „widowmaker“ (zu Deutsch: „Witwenmacher“) sind Baumstämme, die von innen ausbrennen, ihre Standfestigkeit verlieren und völlig unerwartet umstürzen. „Befindet man sich in der Nähe einer solchen Gefahr, ist es zum Weglaufen bereits zu spät. Zu schnell rollt der Tonnen schwere Baumstamm den Steilhang hinab“, erklärt Stengele das unberechenbare Risiko.
Zusammenhalt. „Bei Einsätzen wie diesen, in denen man sich auf die Gruppe verlassen muss, ist das Miteinander und das Vertrauen das A und O“, so Stengele, der als Gruppenkommandant das Wohlergehen seiner Mannschaft ständig im Blick hat. Geht es einem im Team nicht gut, findet man eine Lösung, und wenn der Einsatz für den Tag abgebrochen werden muss, ist das so. „Am Ende des Tages zählt nur, dass alle gesund zurückkommen“, macht Stengele unmissverständlich klar. Wenn Feuerwehrkräfte, Politiker und Hubschrauberpiloten am Abend zusammensitzen und sich austauschen, wird jedem noch deutlicher bewusst, dass sie gemeinsam für eine gute Sache kämpfen. Aber auch von seinem Arbeitgeber Hilti erhält Stengele große Unterstützung. Der Liechtensteiner Bautechnologiekonzern unterstützt dabei nicht nur den Feuerwehrmann selbst, indem er nach interner Abklärung zeitnah in den Einsatz fahren kann, sondern auch @fire Germany. Seit Jahren fördert Hilti die Organisation, dabei werden auch die Einsätze mit Hilti Geräten jeglicher Art ausgestattet.
Einsatzende. Für die Organisation @fire endete der Einsatz am 5. August. Bis das erhoffte „Brand aus“ gegeben werden kann, dauert es über drei Wochen, und erst der prognostizierte Regen sorgt für eine Entspannung der Lage. Rund 800 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und privaten Helfern mit Unterstützung von 15 Hubschraubern standen im Löscheinsatz. Insgesamt neun Tage kämpfte Markus Stengele gegen das Feuer. Nach den ersten fünf Tagen geht es für ihn auf Heimaturlaub, beim zweiten Einsatz begleitet ihn seine Vorarlberger Kameradin Jessica Bily, die zum ersten Mal in einen Waldbrandeinsatz geschickt wird. Zwei Monate zuvor haben sich die beiden in Portugal bei einer Waldbrandübung auf genau so ein Szenario vorbereitet, Erfahrungen, die ihnen zugutegekommen sind. Mit Harald Rachlinger und David Öhlinger waren zwei weitere Österreicher an der deutsch-tschechischen Grenze vor Ort.
Zur Person

Der Vorarlberger Markus Stengele ist seit 14 Jahren Feuerwehrmann bei der BtF Hilti Schaan (Liechtenstein) und FF Rankweil.
Seit sieben Jahren engagiert er sich in der gemeinnützigen Organisation @fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e. V., wo er
neben weltweiten Einsätzen auch als Ausbilder tätig ist.
Seine letzten Einsätze:
Hafenexplosion in Beirut (2020), Hochwasserkatastrophe in Deutschland (2021) und Hilfseinsatz an der ukrainischen Grenze (2022)



Einsatz